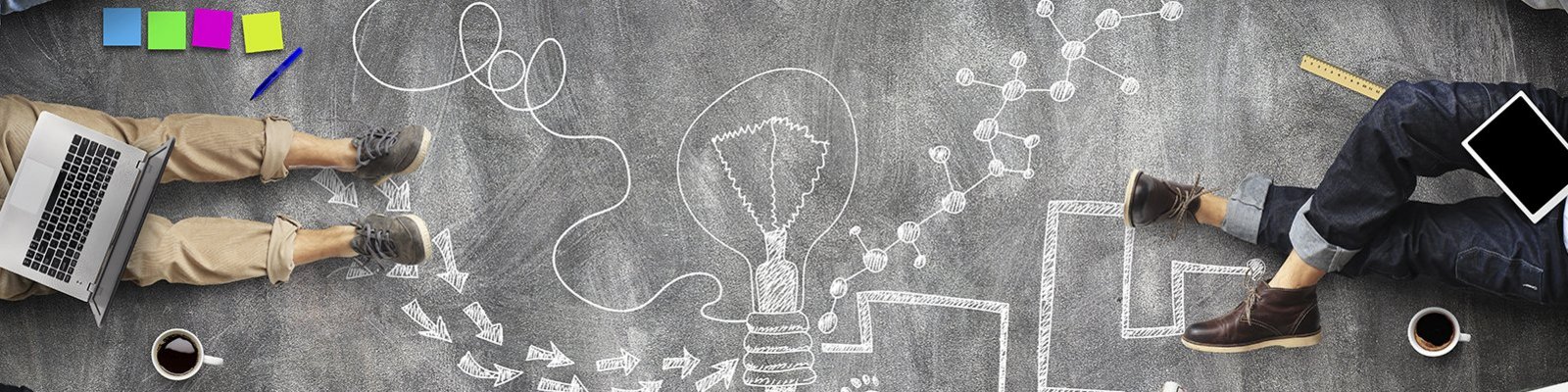Saarland
Rehlinger: Saarland soll auch 2030 Industrieland sein
Betriebsrat: Ford beendet Kurzarbeit
Arbeitswelt
CSU-Generalsekretär: Keine Garantie für Fortbestand von Industriejobs
WSI: Beschäftigte ohne Tarifvertrag arbeiten länger
Eurozone: Arbeitslosenquote steigt im September auf 8,1 Prozent
Konjunktur
ISM-Index für US-Industrie fällt im September zurück
Wirtschaftspolitik
Brexit-Streit: EU-Kommission leitet rechtliche Schritte gegen London ein
Kempf: Deutsche Industrie hofft auf klaren Wahlausgang in den USA
Umweltpolitik
VDA kritisiert Erneuerbare-Energien-Ziel des Umweltministeriums als zu lasch
Steuern / Haushalt
Regierung legt Jahressteuergesetz vor
Studie: Vollständige Abschaffung des Solis wäre ein beachtlicher Konjunkturimpuls
Saarland
Rehlinger: Saarland soll auch 2030 Industrieland sein
Das Saarland soll auch 2030 vor allem ein Industrieland sein. Das sagte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger gestern beim Transformations-Dialog der Arbeitskammer des Saarlandes. Allerdings sei es noch offen, ob der Fokus so stark wie bisher auf der Autoindustrie liegen werde. Sie könne sich auch einen breiteren Branchenmix vorstellen. „Deshalb dürfen wir bei der Ansiedlungspolitik nicht müde werden“, sagte sie. Die Tatsache, dass das Land vor allem verlängerte Werkbank von Konzernen in anderen Bundesländern sei, ließe sich nur dadurch ändern, dass auch verstärkt Unternehmen mit Wachstumspotenzial angesiedelt werden. „Wir sollten deshalb auch Ansiedlungen mit 200 Mitarbeitern nicht negativ sehen“, sagte sie. (Quelle: VSU)
Betriebsrat: Ford beendet Kurzarbeit
Das Saarlouiser Ford-Werk beendet vorläufig die Kurzarbeit und kommt wohl bis Ende des Jahres ohne sie aus. Das teilte der Betriebsrat der Saarbrücker Zeitung mit. Voraussichtlich werde Ford in diesem Jahr insgesamt 182.000 Autos in Saarlouis gebaut haben, hieß es. Damit liege das Werk knapp ein Viertel unter den im März kalkulierten Zahlen. Das Werk fährt aber nicht mit voller Auslastung. Mit zwei Schichten sollen 1115 Autos pro Tag gefertigt werden, 1160 wären drin. (Quelle: Saarbrücker Zeitung)
Arbeitswelt
CSU-Generalsekretär: Keine Garantie für Fortbestand von Industriejobs
CSU-Generalsekretär Blume hält in Folge des Strukturwandels und der Corona-Krise den Niedergang von Industrieberufen für möglich. Die Politik könne keine Garantie dafür geben, "dass bestimmte Berufsbilder oder Geschäftsmodelle auf Dauer fortbestehen", sagte Blume mit Blick auf Facharbeiter in der Industrie, vor allem im Automobil- und Zuliefersektor, die von der Forschungsförderung der bayerischen Staatsregierung kaum profitieren werden. Laut Blume dürfe der Strukturwandel nicht verhindert werden. "Irgendwann käme es viel schlimmer, dann gäbe es den Strukturbruch und tote Regionen", sagte der Generalsekretär. Einen drastischen Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Industrie fürchtet Blume allerdings nicht: "Ich sehe jedenfalls keine Anzeichen für eine drohende Massenarbeitslosigkeit." Er verweist auf die jüngsten Arbeitsmarktdaten, die "recht ermutigend" seien. Derzeit werde alles dafür getan, "um gerade den Mittelstand bei dem notwendigen Übergang in die neue Zeit zu unterstützen", sagte Blume. (Quelle: Mittelbayerische Zeitung, M+E-Newsletter Gesamtmetall)
WSI: Beschäftigte ohne Tarifvertrag arbeiten länger
In Deutschland arbeiten einer WSI-Studie zufolge immer mehr Beschäftigte in Betrieben ohne Tarifvertrag. Im vergangenen Jahr seien die Arbeitsbedingungen von nur noch 52 Prozent der Beschäftigten tarifvertraglich geregelt gewesen, während zur Jahrtausendwende noch 68 Prozent der Beschäftigten mit Tarifvertrag gearbeitet hätten, so das Institut. Im Jahr 2018, dem aktuellsten, für das auch differenzierte Länder-Daten vorliegen, waren es 54 Prozent. Im Vergleich der Bundesländer liegen NRW und Niedersachsen mit 60 Prozent vorn, Schlusslicht ist Sachsen mit 40 Prozent. Der Rückgang der Tarifbindung habe erhebliche Folgen für Arbeitszeit und Bezahlung, betonen die Autoren: Vollzeitbeschäftigte in tariflosen Betrieben arbeiteten bundesweit im Schnitt wöchentlich 53 Minuten länger und verdienten 11 Prozent weniger als Beschäftigte in Betrieben mit Tarifbindung. Laut WSI wurden dabei Betriebe miteinander verglichen, die hinsichtlich Größe, Wirtschaftszweig, Qualifikation der Beschäftigten und Stand der technischen Anlagen vergleichbar seien. Längere Arbeitszeiten in tariflosen Betrieben seien in den westdeutschen Bundesländern besonders ausgeprägt, und zwar auch dann, wenn man strukturelle Effekte wie Betriebsgröße und Branche herausrechne. In Baden-Württemberg arbeiteten Vollzeitbeschäftigte in tariflosen Unternehmen jede Woche 72 Minuten zusätzlich, in Bremen seien es 64 Minuten. Beim Entgelt zeigen sich die größten Nachteile im Osten: In Brandenburg verdienten Beschäftigte in tariflosen Betrieben monatlich 17,7 Prozent weniger als Arbeitnehmer in vergleichbaren Betrieben mit Tarifbindung, in Sachsen-Anhalt betrage der Abstand sogar 18,3 Prozent. (Quelle: WSI, dpa, M+E-Newsletter Gesamtmetall)
Eurozone: Arbeitslosenquote steigt im September auf 8,1 Prozent
Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone hat sich im August erhöht. Nach Eurostat-Angaben stieg die Arbeitslosenquote auf 8,1 Prozent, nachdem sie im Juli bei revidiert 8,0 (vorläufig: 7,9) Prozent) gelegen hatte. In der gesamten EU-27 betrug die Arbeitslosenquote 7,4 (Vormonat: 7,3) Prozent. Nach Schätzungen von Eurostat waren im August in der Eurozone 13,188 Millionen Menschen und in der gesamten EU 15,603 Millionen Menschen arbeitslos. Gegenüber Juli 2020, stieg die Zahl der arbeitslosen Personen in der EU um 238.000 und im Euroraum um 251.000. (Quelle: Eurostat, M+E-Newsletter Gesamtmetall)
Konjunktur
ISM-Index für US-Industrie fällt im September zurück
Die Aktivität in der US-Industrie hat sich im September verlangsamt, zeigt der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes, der auf 55,4 von 56,0 Punkten im Vormonat zurückgegangen ist. Unter den Unterindizes fiel der für Neuaufträge deutlich auf 60,2 (Vormonat: 67,6), jener für die Produktion gab auf 61,0 (Vormonat: 63,3) nach. Dagegen zog der Index für die Beschäftigung auf 49,6 (Vormonat: 46,4) an, während der Subindex der Preise einen Anstieg auf 62,8 (Vormonat: 59,5) auswies. (Quelle: Dow Jones, M+E-Newsletter Gesamtmetall)
Wirtschaftspolitik
Brexit-Streit: EU-Kommission leitet rechtliche Schritte gegen London ein
Im Brexit-Streit leitet die EU-Kommission rechtliche Schritte gegen Großbritannien wegen Verletzung des EU-Austrittsvertrags ein, kündigte Kommissionspräsidentin von der Leyen an. Hintergrund ist das britische Binnenmarktgesetz, das am Dienstag vom Unterhaus beschlossen wurde und das Teile des bereits gültigen Austrittsvertrags aushebeln soll. Die EU-Kommission hatte der britischen Regierung ein Ultimatum bis Mittwoch gesetzt, die umstrittenen Klauseln des Gesetzes zurückzunehmen. Da dies nicht geschah, verschickte die Brüsseler Behörde nun eine offizielle Anzeige nach London, dass sie eine Verletzung des Vertrags sieht. Von der Leyen gab der britischen Regierung einen Monat zur Stellungnahme. Es ist der erste Schritt eines Verfahrens, das letztlich vor dem EuGH enden könnte. Das Binnenmarktgesetz wäre ein Verstoß gegen das im Vertrag festgelegte Prinzip des „guten Glaubens“ und konkret gegen das Protokoll für Nordirland, sagte von der Leyen. Trotz des nun gestarteten Verfahrens werde die EU weiter auf volle Einhaltung des Austrittsvertrags pochen und sich selbst auch daran halten: „Wir stehen zu unseren Verpflichtungen.“ (Quelle: dpa, M+E-Newsletter Gesamtmetall)
Kempf: Deutsche Industrie hofft auf klaren Wahlausgang in den USA
Die deutsche Industrie blickt mit Sorge auf ein drohendes Chaos nach der US-Präsidentschaftswahl am 3. November. "Ein klarer Wahlausgang ist einer Hängepartie vorzuziehen", sagte BDI-Präsident Kempf: "Deshalb hoffe ich fest auf einen eindeutigen Ausgang der Präsidentschaftswahl. Unternehmen sind auf Planungssicherheit angewiesen." Das betreffe besonders die künftige Gestaltung eines regelbasierten Handels und gemeinsame Anstrengungen, um die Corona-Pandemie unter Kontrolle zu halten und die weltwirtschaftliche Erholung nicht zu gefährden. (Quelle: Reuters, M+E-Newsletter Gesamtmetall)
Umweltpolitik
VDA kritisiert Erneuerbare-Energien-Ziel des Umweltministeriums als zu lasch
VDA-Präsidentin Müller hat das Ziel des Umweltministeriums für erneuerbare Energien bei Kraftstoffen als „nicht ambitioniert genug“ kritisiert: “Für einen wirksamen Beitrag des Verkehrssektors zum Klimaschutz muss viel stärker als bisher bei den Energieträgern, wie Kraftstoffen und Strom, angesetzt werden.” Der VDA fordere daher einen Anteil von mindestens 23 Prozent erneuerbarer Kraftstoffe und eine Mindestquote von 5 Prozent Wasserstoff bis 2030. Das Umweltministerium hatte das frühere Ziel von 14 Prozent verschärft. Dieses solle nun schon 2026 statt 2030 erreicht werden. Allerdings darf dafür – gemäß EU-Vorgaben – etwa der Einsatz von Ökostrom mehrfach angerechnet werden. Der VDA fordert die 23 Prozent ganz ohne mehrfach Anrechnungen. Die Pläne des Umweltministeriums bildeten so keinerlei Anreize für Investitionen in erneuerbare Kraftstoffe, kritisierte Müller weiter. (Quelle: Reuters, M+E-Newsletter Gesamtmetall)
Steuern / Haushalt
Regierung legt Jahressteuergesetz vor
Die Bundesregierung strebt mit dem von ihr eingebrachten Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2020 eine Vielzahl von Änderungen im Steuerrecht an, darunter eine Verlängerung der geltenden Regelung, nach der Arbeitgeberzuschüsse zum Kurzarbeitergeld steuerfrei bleiben. Diese Regelung soll bis Ende des Jahres 2021 verlängert werden. Zu den Änderungen gehört weiterhin, dass EU-weit agierende Unternehmen nicht mehr in jedem Mitgliedstaat einzeln ihre Steuerpflichten erfüllen müssen. Dies kann in Zukunft allein im Heimatland des Unternehmens über ein Webportal erfolgen, wo die Mehrwertsteuer zentral für alle Online-Umsätze abgerechnet wird. Steuerbetrug von Händlern aus Ländern, die nicht zur Europäischen Union gehören, soll intensiver bekämpft werden. Geplant ist, dass Betreiber von Online-Marktplätzen fiktiv in die Lieferkette eingebunden und damit stärker in die Pflicht genommen werden. Außerdem gibt es Änderungen bei der Besteuerung von Zusatzleistungen des Arbeitgebers. (Quelle: Bundestag, M+E-Newsletter Gesamtmetall)
Studie: Vollständige Abschaffung des Solis wäre ein beachtlicher Konjunkturimpuls
Die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags würde das BIP im kommenden Jahr um sechs Milliarden Euro anheben und 19.000 zusätzliche Arbeitsplätze schaffen. Die positiven Effekte auf Wirtschaftswachstum und Arbeitsmarkt würden den zu erwartenden Steuerausfall um rund ein Drittel reduzieren, zeigen aktuelle IW-Berechnungen und Simulationen für die INSM. "30 Jahre nach der Einheit ist der Soli schlichtweg aus der Zeit gefallen. Statt ihn zum Ende des Jahres nur zur Hälfte abzuschaffen, sollte die Bundesregierung einen Schlussstrich unter die über 25 Jahre alte Ergänzungsabgabe machen", so INSM-Geschäftsführer Pellengahr: "Dieser Schritt wäre nicht nur steuersystematisch überfällig und verfassungsrechtlich geboten, sondern brächte zusätzlich einen beachtlichen Konjunkturimpuls." Wie groß dieser Impuls ausfallen könnte, hat das IW mit Hilfe des sogenannten "Oxford-Modells" berechnet. Anhand des Oxford-Modells können im Rahmen von Simulationen die Effekte einer Aufkommensveränderung dargestellt werden. Studien-Co-Autor Hentze: "Eigentlich ist es ein Glücksfall für die Politik, wenn strukturell überfällige Schritte mit konjunkturpolitisch sinnvollen Schritten zusammenfallen. Mit der vollständigen Soli-Abschaffung könnte eine überfällige Reform als wirtschaftlicher Impuls zur Überwindung der Corona-Krise genutzt werden. Der Effekt auf die Steuereinnahmen wäre dabei geringer als eine statische Betrachtung nahelegt, da die zusätzliche wirtschaftliche Dynamik einen Teil des Aufkommensverlusts kompensieren kann." Die INSM ist weiterhin davon überzeugt, dass der Solidaritätszuschlag seit Anfang dieses Jahres verfassungswidrig erhoben wird und hat eine entsprechende Klage eingereicht; sie befindet sich auf dem Weg durch die Instanzen. Mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts wird in naher Zukunft gerechnet. Pellengahr: "Sollte das Bundesverfassungsgericht den Soli für verfassungswidrig erklären, kämen hohe Rückzahlungsforderungen auf die Bundeskasse zu. Mit einem politischen Ende des Solis könnte die Bundesregierung dieses Risiko reduzieren, Arbeitsplätze schaffen und gleichzeitig einen wichtigen Konjunkturimpuls setzen." (Quelle: INSM, IW, M+E-Newsletter Gesamtmetall)